
Ich arbeite seit 2009 bei der Diakonie Hasenbergl. Hier kann ich meinen Weg gehen, in meinem Tempo und in Form von verschiedenen Aufgaben und immer mit Unterstützung des Trägers. Erst im Gruppendienst im Wichern-Zentrum, dann als Leitung der ambulanten Erziehungshilfen. Im November 2022 habe ich zunächst die Leitung des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SpDi) und des Betreuten Einzelwohnens bis 60 Jahre (BEW-60) übernommen und bin kürzlich wieder ins Wichern-Zentrum zurückgekehrt, als Leitung der HPT SFK und stellvertretende Leitung der HPT Schule. Das fühlt sich einfach richtig an. Hier kann ich meine langjährige Berufserfahrung als Diplom-Sozialpädagogin voll einbringen.
Die erste Berührung mit den Mitwirkungsmöglichkeiten, die es in der Diakonie Hasenbergl gibt, hatte ich gleich in den ersten Monaten. Von anderen Trägern kannte ich das nicht. Ich habe beim Qualitätszirkel für einen neuen Krisenordner mitgearbeitet, und nicht nur das Grundprinzip Partizipation kennengelernt, sondern auch viele neue Kolleg*innen und ihre Arbeitsbereiche. 2014 habe ich die Leitungsstelle der Ambulanten Erziehungshilfen (AEH) übernommen und nur wenige Monate später mit der Leitungsqualifikation begonnen. Fortbildungen, Weiterbildungen, Qualitätszirkel – ich nehme gerne teil und arbeite in verschiedenen Arbeitsgruppen mit. Was ich lerne, gebe ich weiter – an Kolleg*innen in meinem Team und aus anderen Einrichtungen, z.B. in Form von Inhouse-Schulungen im Sinne von zusammen.tun.
Ich bin jetzt seit fast zehn Jahren Leitung. Mir ist es sehr wichtig, mit meinen Kolleg*innen in meinem Team auf Augenhöhe zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig braucht es eine Klarheit hinsichtlich der Rollen und Verantwortung im Team und einen wertschätzenden Umgang mit einander. Mir macht es Spaß, verantwortlich zu sein.
Ich führe sehr gerne kollegiale Beratungen durch. Seit längerem arbeite ich auch für den Krisendienst, während der Pandemie zuerst als Springerin, jetzt gehört es neben meinen Leitungsaufgaben zu meinen festen Aufgaben. Das Erlebte abends wieder los zu lassen, musste ich lernen: Wo sind meine Grenzen? Was sind meine Aufgaben? Was ist meine Verantwortung? Was belastet mich?
Begonnen hatte ich als Erzieherin 1986 in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, nach dem Studium zur Sozialpädagogin habe ich über 40 Jahre in der Jugendhilfe gearbeitet, dann in der Sozialpsychiatrie und jetzt wieder in der Jugendhilfe. In allen beruflichen Stationen habe ich festgestellt: Hier kann ich meinen Weg gehen. Und deshalb bin ich hier richtig.

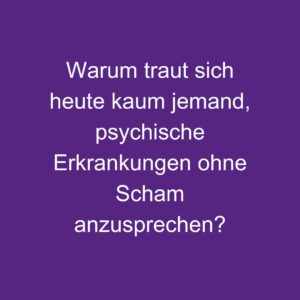
Warum traut sich heute noch niemand, psychische Erkrankungen ohne Scham anzusprechen? Das ist eine der Fragen, die mich seit einigen Jahren beschäftigen.
Psychische Erkrankungen sind leider immer noch mit einem Stigma versehen in unserer Gesellschaft. Dabei sind die Fakten klar: Eine psychische Erkrankung kann jede*n treffen. Jeder dritte Mensch erkrankt einmal im Leben an einer Depression. Und die Depression hat unterschiedliche Ausprägungen, geht nicht einfach wieder weg.
Das trifft ganz allgemein auf psychische Erkrankungen zu,: sie verschwinden nicht einfach, man kann sie nicht aussitzen, das geht nicht. Bei einer psychischen Erkrankung gibt es in der Regel irgendwann im Laufe des Lebens eine Diagnose. Aus unterschiedlichen Anlässen, etwa weil ein*e Patient*in psychotisch oder wahnhaft wird, Stimmen hört, sich bedroht und verfolgt fühlt. Für sich keinen Ort findet, an dem sie sich sicher und zu Hause fühlen kann. Diese Erkrankung muss behandelt werden, in der Klinik,,teilstationär, ambulant und/oder mit Medikamenten. Die Seele muss erst einmal zur Ruhe kommen, ehe man die Behandlung und Therapie beginnen kann.
Menschen, die an psychischen Erkrankungen leiden, leben immer damit, dass sie nicht wissen, wann es wieder einen Schub geben kann. Sie sind oft stressanfällig, manchmal auch nicht so belastbar in der Arbeitswelt. Bei einigen kann Drogenkonsum die Erkrankung auslösen. Wir wissen heute, dass schon ein einmaliger Gebrauch von speziellen neuartigen Drogen aus reicht, dass junge Erwachsene eine psychotische Phase entwickeln, die sie unter Umständen ihr Leben lang begleiteten kann.
Menschen mit psychischen Erkrankungen sind nicht verrückt. Aber die Seele ist richtig krank. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass sich in einer depressiven Phase das Leben anders anfühlt, oft grauer und für viele schwerer. Du hast jeden Morgen die Aufgabe, den Mount Everest zu besteigen.
Eine psychische Erkrankung heißt aber nicht, dass man nicht arbeiten kann: Man kann seinen Weg gehen, man kann Kinder großziehen. Es ist nur anders. Ich würde mir wünschen, dass die Menschen ein bisschen die Scheu verlieren. Dass sie eine psychische Erkrankung als Erkrankung sehen, die jeden von uns treffen kann. Jeder Mensch hat es verdient, dass ihm mit Respekt und Wertschätzung gegenübergetreten wird.
Ich lebe selbst mit der Diagnose Depression. Ich habe lange überlegt, ob ich das offen erzählen möchte. Gleichzeitig denke ich mir: Wenn ich das nicht sage, wer dann? Mein Platz hier ist richtig, genau weil ich es sagen kann. Mein Team weiß von meiner Erkrankung und auch andere Kolleg*innen, mit denen ich zusammenarbeite. Bin ich durch meine Erkrankung anders als meine Kolleg*innen? Arbeite ich anders oder mache ich einzelne Dinge anders? Nein, weder noch. Ich habe erfahren, dass eine Depression sehr gut behandelt werden kann, mit Therapie, mit Medikamenten, mit Beratung. Eine Depression lässt sich in der Regel so einstellen, dass man gut leben kann, fröhlich leben kann und alles in Ordnung ist.
Und gleichzeitig kriegt man mehr Respekt vor anderen psychischen Erkrankungen. Die machen Menschen Angst, sie fühlen sich anders und nicht verstanden, seltsam, manchmal auch verrückt. Alle Kolleg*innen im SpDi sind geschult, mit diesen Erkrankungen umzugehen und den Menschen, die daran leiden, Unterstützung zu bieten. Dem Thema Aufklärung kommt deshalb eine besonders wichtige Bedeutung zu; auch die Themen Demenz und Alzheimer werden einen Platz bekommen, weil ja auch ältere Menschen dort leben, in unserer Verantwortung, in unmittelbarer Nachbarschaft. Und ich finde das ganz wichtig, dass wir aufeinander achten und uns miteinander entwickeln.
